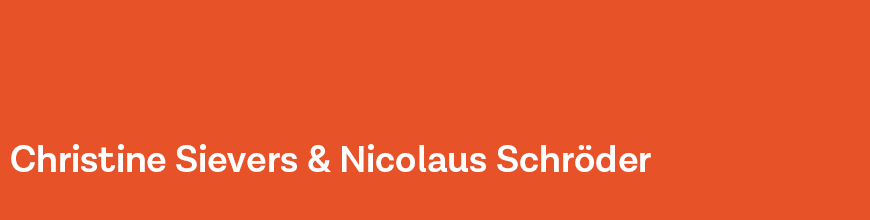Klaus Wildenhahn, Dokumentarist Freunde der deutschen Kinemathek (Hg.), Nicolaus Schröder (Redaktion)
Klaus Wildenhahn, Dokumentarist Freunde der deutschen Kinemathek (Hg.), Nicolaus Schröder (Redaktion)
Schröder: Bei PANORAMA war deine Berufsbezeichnung ‘Realisator’. Wie habt ihr als ‘Realisatoren’ gearbeitet?
Wildenhahn: Die Autoren Lothar Janßen, Albert Krogmann und ich wurden mit einem Journalisten zusammengekoppelt. Wir haben zusammen recherchiert und nach der Recherche hat sich der Journalist ungefähr überlegt, in welcher Form man vorgeht. Dann ist man losgegangen und hat das gedreht. Das war relativ zeitaufwendig. Das ist eine Art von kleinem Spielfilm gewesen, weil man richtig ein Buch entworfen hat. Das war hauptsächlich die Aufgabe des Journalisten. Der Realisator hat sich dann überlegt, wie man es am besten umsetzen kann. Da sind wüste Sachen entstanden mit einer heftigen Symbolik und angestrebter Künstlichkeiten. Das war eine totale Synthetisierung.
S: Hast du dafür ein Beispiel?
W: Ich hab mal den Dom (der Hamburger Jahrmarkt) auf dem Heiligengeistfeld aufgenommen für eine Story über die Berechtigung der Kirchensteuer. Der Jahrmarktrummel sollte für das weltliche Treiben stehen und der Texte sollte diese Bilder dann unterlaufen. So idiotisch hat man sich da ausgedacht. Es hat aber Spaß gebracht.
S: Damals hast Du auch viel mit Archivmaterial gearbeitet.
W: Der zweite Film, DER TOD KAM WIE BESTELLT, ist fast nur aus Archivmaterial und Fotografien, die wir mit Musiken kombiniert haben. Bei DER MERKWÜRDIGE TOD DES HERRN HAMMARSKJÖLD haben wir zusätzlich Aufnahmen gemacht. Den letzten Flug von Hammarskjöld zu inszenieren, war damals meine Idee, das sieht heute beinahe wie ein Doku-Drama aus. Wir sind zu der Fluggesellschaft nach Schweden gefahren, die damals die weissgestrichenen Flugzeuge für die UN stellte, und haben mit den Maschinen einen Nachtflug gemacht. Selbst den Mond, der zur Absturtzzeit herrschte, haben wir zurückrecherchiert und aufgenommen. Das ganze haben wir mit der Musik von Miles Davis zu FAHRSTUHL ZUM SCHAFOTT (L’ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD, Louis Malle, 1957) kombiniert. Die Montage bildete die Rahmenkonstruktion, in die Hinweise auf die politische Situation der Gegenden eingefügt wurden, die das Flugzeug gerade überflog. Das ist eine starke Synthetisierung voller fiktiver Momente, die mit dem quasi-dokumentarischen Text von Uexküll unterlegt wurde.
S: Uexküll, Kogon, Engelmann waren in den sechziger, siebziger Jahren prominente Autoren. Kannst du die damalige Arbeitssituation beschreiben?
W: Das war das öffentlich-rechtliches Fernsehen im besten Sinne. Für mich war es eigentlich eine sehr glückliche Zeit, weil ich zum ersten Mal einen Zusammenhalt spürte. PANORAMA zu Zeiten von (Gert von) Paczensky – das war zuerst einmal ein Flur mit offenen Zimmern. Man hockte zusammen und konnte immer zu irgendwem reingehen. Der zweite Flur, der Schneideraum-Flur befand sich in einem einstöckigen Behelfsbau, in dem die Schneideräume nebeneinander lagen. Zwei waren immer von PANORAMA belegt. Wir arbeiteten meistens mit den Cutterinen Karin Baumhöfner und Kirsten Wedemann. Wir haben uns auch immer Filme geholt. Ich weiss ganz genau, daß wir da zum Beispiel die frühen Free Cinema-Filme von Karel Reisz gesehen haben. Also nicht die Spielfilme, sondern die dokumentarischen Anfänge wie WE ARE THE LAMBETH-BOYS (Karel Reisz, 1958). Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das ging, aber das Fernsehen konnte die Kopien ranholen und wir haben sie uns am Schneidetisch angesehen. Das war eine wunderschöne Situation und die Journalisten gehörten zur absoluten Elite. Das waren tolle Leute, die Augstein damals für ein Tageszeitungsprojekt eingekaufen wollte.
S: Das klingt idyllisch.
W: Sicherlich war die ganze Situation um 1960, 61, 62 empfangsbereiter. Man darf auch nicht vergessen, daß es ja damals keine Filmschulen gab. Die entscheidenden Arenen waren damals Oberhausen und Mannheim. Meine Filmausbildung hat da stattgefunden, weil ich zu diesen Festivals immer hingefahren bin, ich habe das immer hingekriegt. Das ging nachher soweit, dass bei PANORAMA Paczensky aufhorchte und selbst auch mitkam, ausserdem haben wir erreicht, daß ein oder zwei Kameraleute und die Chef-Cutterin mitfuhren. Das Interesse in diesem Umfeld war wirklich groß. Diese Jahre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen waren eine ganz wunderbare Zeit. Man war noch aufgeschlossen und hat das Gesehene auch dikutiert. Das lag natürlich auch am Klima in der Redaktion, das war nicht überall so. Die Aufgeschlossenheit in der damaligen ‘Zeitgeschehen’-Redaktion ging stark auf solche Leute wie Paczensky zurück.
S: Gab es noch andere aufgeschlossene Redaktionen?
W: Neben dem ‘Zeitgeschehen’ war beim NDR die andere Hauptabteilung, das Fernsehspiel, sehr progressiv. Eigentlich könnte man sagen, daß die Innovation, die beim NDR damals gemacht wurden, nach allen möglichen Seiten ausgestrahlt hat. Ich glaube zum Beispiel nicht, daß anfang der sechziger Jahren der deutsche Kinofilm schon so weit war, obwohl über den mehr geredet wurde. Eigentlich innovativ war zu dieser Zeit meines Erachtens ein Sender wie der NDR. Ich hab nicht den Überblick, wie das beim WDR oder beim Süddeutschen Rundfunk gewesen ist, bei denen gab es ja auch diese innovativen Momente, die Stuttgarter Schule und ähnliches.
S: Wie kam es zu deinem ersten Film nach der ‘neuen Methode’?
W: Da war Kogon schon da. Ich hatte Leacock und Genossen inzwischen kennengelernt und so kam noch eine andere Queverbindung zum Tragen. Verantwortlich für die Filmredaktion im Fernsehspiel war damals Hans Brecht, der auch die Hand am Puls der Zeit hatte und vom Cinema Direct gehört hatte. In Lyon nahm Brecht an der entscheidenden Konferenz teil, zu der die kanadischen, französischen und amerikanischen Filmemacher gekommen waren, um ihre Sachen vorzustellen. Das war die entscheidende Präsentation von Cinema Direct und Cinéma Vérité. Ich fuhr um diese Zeit nach Mannheim, weil Leacock, die Maysles und Pennebaker auftreten sollten. Als Brecht erfuhr, daß ich da war , rief er an und sagte, ich sollte mit ihnen Interviews drehen. Dieses Gespräch, ein zehn-Minuten-Film, in dem diese drei, Pennebaker, Al Maysles und Leacock ihre Methode kurz erläutern, gibt es im NDR-Archiv glaube ich noch. Hans Brecht hatte drei Filme von ‘Time Life’ eingekauft und vor den ersten setzte er dieses Interview. So war plötzlich eine Querverbindung zum Fernsehspiel entstanden. Bei PANORAMA war inzwischen (Eugen) Kogon Redaktionsleiter geworden und bei dem drängelte ich, um etwas Anderes auszuprobieren. Ich wollte nicht weiter diese Filme mit den Journalisten drehen. Das hatte mir Spaß gebracht, aber jetzt wollte ich diese neue Methode ausprobieren und für das Zeitgeschehen fruchtbar machen. Kogon hat dem schließlich nachgegeben und gesagt, ‘gut, aber dann machen sie etwas, das nicht politisch ist, sondern machen sie so etwas wie ein Feuilleton’. Er hat mich dann auf einen Parteitag geschickt, weil das ja eher eine langweilige Berichterstattung ist, wollte da nie jemand so richtig hin.
S: Wie waren die Reaktionen auf deinen ersten Cinema Direct-Versuch?
W: Das war dieser kurze Film über den CDU-Parteitag mit Adenauer, als Kogon gesehen hat, was dabei herauskam, bin ich zum CSU-Parteitag und dann zum SPD-Parteitag gefahren. Beim SPD-Parteitag ist dann als Abfallmaterial PARTEITAG 64 entstanden. Den haben wir mit der Cutterin geschnitten, mit der ich den offiziellen kleinen Beitrag für PANORAMA gemacht habe, später haben wir den Film dann Kogon gezeigt, der ihn gut fand. Das war eben diese Geschichte über die Abwahl von Max Brauer.
S: Obwohl der Film nach Oberhausen eingeladen wurde und alle ganz begeistert waren, hat Kogons Nachfolger Joachim Fest sowohl die Fernsehausstrahlung verhindert als auch die Präsentation in Oberhausen. Warum?
W: Das weiß ich auch nicht mehr im Einzelnen.
S: Diese Aufbruchsstimmung zu neuen, filmischen Formen des Fernsehjournalismus brach schnell wieder ab. Woran lag das?
W: Es gibt eine Untersuchung von der Uni in Siegen, die behauptet, daß es eine zeitlang möglich gewesen wäre, den Fernsehjournalismus filmischer zu machen, also wegzubringen vom Wortjournalismus. Etliche Beispiele werden zitiert unter anderem MUTTERTAGS TAG von Albert Krogmann und meine Parteitagsfilme. Das brach ab, ob sich da etwas hätte entwickeln können wenn Kogon geblieben wäre? Ich weiss es nicht. Paczensky war sehr aufgeschlossen und Kogon fand das glaube ich auch ganz interessant. Bei Merseburger war es dann ganz vorbei. Es blieb beim Wortjournalismus, von dem sie immer behauptet haben, das wäre eigentlich das Politische. Ich weiss nicht, ob die These von der Veränderung zum Filmischen stimmt. Durch den Einfluss der Realisatoren mag es in Ansätzen so gewesen sein. Als solche Versuche nicht mehr möglich waren, hat mich Monk zum Fernsehspiel geholt.
S: Mit dem Wechsel waren ja auch ganz andere Filmlängen möglich.
W: Mein Wechsel zum Fernsehspiel und die Möglichkeit, diese große Form zu entwickeln, ist auf jeden Fall günstig gewesen. Als Fernsehspiel waren solche Filme ganz unproblematisch. Sie wurden ganz anders, als eine interessante Form des Fernsehspiels aufgenommen. Im ‘Zeitgeschehen’, im Journalismus hätte man das nicht durchsetzen können. Leacock hat ja eine zeitlang auch vom ‘uncontroled cinema’ gesprochen und dieses Unkontrollierte war im ‘Fernsehspiel’ auf jeden Fall eher als im ‘Zeitgeschehen’ möglich. Damals, ich weiss nicht wie das heute ist, war dort die Kontrolle sehr stark. Bei der Abnahme der PANORAMA-Beiträge saß oft der Programmdirektor mit dabei und guckte, was gemacht wurde.
S: In den siebziger Jahren wurde das NDR-Programm immer konventioneller, die Räume für den dezidierten Nicht-Mainstream wurden immer enger, vor allem auch im Fernsehspiel. Zu den Inseln des Nichtangepassten gehörte lange Zeit die Filmredaktion des NDR-Fernsehspiels. Woran lag das?
W: Ich glaube (der Redakteur) Hans Brecht war der einzige Internationalist und produktive Mensch, der damals noch übergeblieben war. Brecht war ja kein Autor, er verstand sich als Producer. Brecht hatte die ganzen internationalen Verbindungen und die nutzte er für sein Filmprogramm. Er hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, daß Marcel Ophuls für den NDR arbeitete. Er war ein guter Redakteur, der seine Hauptaufgabe darin sah, das Interessante des Filmgeschehens zu präsentieren und er hatte nicht den Ehrgeiz gleichzeitig auch noch eigene Fernsehspiele zu produzieren.
S: Du machst bei allen Filmen den Ton selbst, wie kam es dazu?
W: Während der Vorbereitung von HARLEM THEATER habe ich eine zeitlang in New York gelebt. Ich wollte kein Team rüberholen, aber trotzdem schon in New York arbeiten. (Der Kameramann) Christian Blackwood, der in dem Umfeld von Leacock aufgewachsen war und die Cinema-Direct-Technik kannte, gab mir den Anstoß, den Ton selber zu übernehmen. Davor hatte ich immer mit (dem Kameramann Rudolf) Körösi und Herbert Selk (als Tonmann) gearbeitet.
S: Hattest du schon vorher Erfahrung als Tonmann?
W: Bei den ersten Filmen mit Körösi und Selk habe ich normalerweise immer das Mikro mit einer etwas längeren Strippe gehalten. Und Selk, der Tonmann, hielt sich zurück, also sozusagen in der räumlichen Distanz zu den eigentlichen Leuten. Ich war schon immer derjenige, der mit dem Mikro die Bezugsperson für die Protagonisten darstellte. Es war eigentlich dann auch richtig, den letzten Schritt zu machen und die Nagra, nachher die Stellavox, selber zu tragen. So zu arbeiten, ist die ideale Kombination für diese Sorte von Film.
S: Wie ist das räumlich, stehst du eher in der Nähe der Kamera?
W: Wir stehen oft beisammen, Wolfgang Jost und ich oder Gisela Tuchtenhagen und ich, meistens stehe ich aber näher am Geschehen. Der Ton hat ja keine Gummilinse, also muß ich auch immer dichter ran. Der Kameramann und die Kamerafrau können sich also ruhig zurückhalten und etwas mehr im Hintergrund arbeiten, weil sie mit dem Zoom ja auch besser rankommen.
S: Gibt es eine grundsätzliche Eigenschaft, die dir bei Kameraleuten wichtig ist?
W: Dass sie sich nicht aufdrängen, also nicht durch die Gegend laufen und in Räumen rumstöbern, um neue interessante Kamerapositionen zu finden. Der Kameramensch sucht sich einen Punkt und bleibt da, nur ich muss mich mit dem Ton bewegen. Dadurch gebe ich die Richtung des Geschehens an. Der Kameramann weiss: Wo das Mikro ist, da ist die Action. Wobei natürlich klar ist, daß die Kamera wegschwenken kann, um die Off-Bilder zu machen, von denen ich oft spreche, die besonders Gisela Tuchtenhagen sehr gut macht. Der Redende muß nicht immer im Bild sein man kann auch wegschwenken.
S: Beeinflusst deine Konzentration auf den Ton die Wahrnehmung einer Situation?
W: Mit der üblichen literarischen Übertreibung behaupte ich gerne, daß bei den Filmen der Ton wichtiger ist, als das Bild – was natürlich so nicht stimmt. Ich sage das nur, um zu betonen, daß die Töne also nicht nur das Reden sondern auch die Töne dazwischen, die Geräusche, auch die Musik, die irgendwie am Rande entsteht, daß die für mich schon immer eine große Wichtigkeit hatten. Im Allgemeinen sagt man ja, man könne den Ton im Notfall weglassen, dann wäre der Film immer noch als Film vorhanden. Doch ich glaube, wenn man den Ton weglässt, werden die Filme flach. Ohne Ton geht es eigentlich nicht.
S: Was macht einen Ton zu einem ‘guten Ton’?
W: Aus der technischen Sicht eines Toningenieurs, mach ich wahrscheinlich gar keinen so sehr guten Ton, sondern eher einen dilettantischen, weil ich zum Beispiel nicht alle technologischen Hilfsmittel einsetze, die ein erfahrener Tonmann einsetzen würde. Ich hefte keine Knopfmikrofone an, ich arbeite auch nicht mit einer Angel, weil ich das zu auffällig finde. Ich hab also immer nur dieses Richtmikrofon und das klemme ich mir manchmal sogar unter den Arm, um in einer bestimmten Haltung, die sich dann nicht verändert, stehen zu können. Also im technischen Sinne ist es gar nicht so ein hervorragender Ton, aber was ich über die Qualität des Tones versuche auszudrücken, ist folgendes: Der Ton, glaube ich, trägt die Tiefe in den Film. Das Filmbild selbst ist flach und erst durch den Ton entsteht die Räumlichkeit. Das sind zum Beispiel Geräusche, die aus einem Nebenzimmer kommen können, aus offenen Fenstern, wenn man auf der Straße steht, das sind Rollergeräusche von Kindern, vielleicht legt irgendeiner eine Platte auf, wie bei DER NACHWELT EINE BOTSCHAFT mit dem Arbeiterdichter Westerhoff, als wir an der Straße seiner Siedlung stehen. Was da plötzlich von allen Seiten für Geräusche auf uns einströmen, die Tauben, die abfliegen, die Rockmusik aus dem offenen Fenster, solche Sachen tragen dazu bei, daß hinter dem Bild der Raum entsteht.
S: Wie bearbeitest du Töne, ich habe zum Beispiel keine Überblendungen gehört?
W: Nein nie! Beim Schnitt wird hart geschnitten und ich habe nur in den aller seltensten Fällen überlappende Töne. Also ich hab immer sehr viel Wert auf diese berühmte Synchronität gelegt. Viele sagen, ‘warum eigentlich, man kann den Ton doch auch verziehen’. Ich fand das immer äusserst spannend, was man zur gleichen Zeit einfängt. Da spielt auch das Prinzip des Zufalls eine große Rolle. In einer bestimmten Situation gelingt es einem und dann geschieht es: Man verzieht es nicht hinterher künstlich, sondern es geschieht in dem Augenblick. Man fängt es ein und dann hat man es. Das sind für mich die magischen Momente, die genau diese Drehmethode, diese Aufnahmemethode ausmachen.
S: In einer Zeit als Fernsehen noch eine Art bebildertes Radio war, ein texthöriges Medium mit einem alles erklärenden Kommentar, bist du angefangen Filme zu drehen, die über weite Strecken keinen Kommentar haben. Trotzdem hast du nie ganz auf Text verzichtet?
W: Meine Begegnung mit Leacock und Vertretern des Cinema Direct hat mich so stark beeinflusst, daß ich diese Methode unbedingt anwenden und hier bei uns durchzusetzen wollte. Die Entdeckung des Cinéma Vérité war für mich ein erlösender Moment. Sicherlich auch um mich selber zu überzeugen und das ordentlich vortragen zu können, habe ich damals immer betont, daß der Text aus den Filmen möglichst verschwinden solle. Filme ganz ohne Text zu machen, hatten die Amerikaner zu ihrem Credo erhoben, nur die Beobachtung zählte. Das habe ich auch immer behauptet, dabei habe ich gleich in den ersten Filmen, zu denen mir zuerst (der Musikredakteur Hansjörg) Pauli und der (Fernsehspielchef Egon) Monk die Möglichkeit gaben, sofort Text eingesetzt. Als ‘Fußnoten’ habe ich das selber immer etwas entschuldigend bezeichnet. Bei IN DER FREMDE sind es ja wirklich ganz sparsame Texte, die einem nur weiterhelfen sollen, damit man die Szenen besser versteht. Obwohl ich das Cinema Direct propagierte, habe ich ganz offensichtlich diese empirische Beobachtungsmethode als selbstverständlich vorausgesetzt und mir rausgenommen, was die Amerikaner nicht gemacht haben: Daß ich knappe Texte einsetze und vor Allem –ganz wesentlich– Titel einsetze. Also ohne mich jetzt literarisch hochmotzen zu wollen, bilde ich mir ein, daß ich das von Brecht habe.
S: Von Brecht?
W: Seine Verfremdungstheorie hat mir immer sehr eingeleuchtet. Dieses sich distanzieren und dann in Vorhängen etwas zu schreiben, eine Szene deutlich zu machen, ‘jetzt geht es da hin!’, das hab ich irgendwo internalisiert für mich, das habe ich sofort angewendet. Bei AVANTGARDE FÜR SIZILIEN habe ich auch Zitate benutzt, beim Jimmy Smith (SMITH, JAMES O. – ORGANIST) sind die Texte, die einem so rüberhelfen, sehr knapp.
S: HARLEM THEATER wirkt montierter als zum Beilspiel IN DER FREMDE, wie kommt das?
W: Das hing für mich mit dem Thema zusammen. Ich war ja ein absoluter Aussenseiter und wollte das auch signalisieren. Deshalb hab ich ja auch keinen direkten Film über Harlem, oder ein schwarzes Getto gemacht, das hätte ich mir nie zugetraut. Ich hatte immer das Gefühl, das müssten Schwarze machen. Als Aussenseiter habe ich einen Film über die Problematik gedreht und dafür mit einer Theatertruppe eine übersetzte Form gewählt, die –natürlich schon in künstlicher Form– etwas von der Stimmung widerepiegelt.
S: Du beschreibst aber nicht nur die Probensituation.
W: Dazwischen habe ich Ausflüge mit der Feuerwehr montiert, um so auch immer meine Position zu zeigen: Ein Weißer geht in das Getto. Mit Zitaten von Eldridge Cleaver und LeRoi Jones habe ich das Material später nocheinmal anders gebrochen, um meine Position zu zeigen, die sehr viel entfernter ist. Das ist das selbe Prinzip wie bei AVANTGARDE FÜR SIZILIEN. Von einem modernen Musikfestival verstehe ich nichts, von Sizilien auch nicht. Ich muß das Material quasi aufbrechen nur um zu zeigen, wie es einem gelingen könnte, gewisse Sachen einzufangen. Diese Form des Aufbrechens, der Zwischenzitate, der unterschiedlichen Blickweisen mit den Entscheidungen für diesen Angang oder jenen hat es neben den durchgehenden Cinema-Direct-Stücken immer gegeben. In diesen Filmen gab es trotzdem immer irgendwo eine ganz dokumentarische Entfaltung, die aber eingerahmt und mit anderem Material, mit anderen Beobachtungen versetzt wurde. Also ich nenne das den ‘poetischen Film’, das hab ich mir von Wertow geholt, der nennt das den ‘poetischen Film’.
S: Der Ton ist puristisch, auch bei Übersetzungen bleibt der Originalton unangetastet.
W: Die Übersetzungen sind wichtig, aber die Zweisprachigkeit muß erhalten bleiben. Das habe ich später besonders gemerkt. Zum Beispiel bei dem YORKSHIRE-Film haben die Texte eine Wichtigkeit und ich habe sie immer so gesetzt , daß man das Englische verstehen kann und trotzdem das Deutsche mitbekommt. Beim Umgang mit Zweisprachigkeit ist Vieles glaube ich auch Instinkt gewesen. Gegen bestimmte Fernsehmaschen, die von allen Seiten auf einen einströmten, habe ich immer gearbeitet. Darum keine Analysen, kein Zugriff des Autoren, der bestimmt was der Zuschauer sehen soll! Das stimmt ja, das habe ich so gemacht, aber durch diesen Umgang habe ich meinen Textanteil versteckt, vielleicht auch vor mir selber. Mit der Zeit ist mir das ein bisschen klarer geworden, richtig aufgegangen ist es mir aber eigentlich erst jetzt auf der Rente.
S: Mich überrascht, wie spät dir die Wichtigkeit der Texte in deinen Filmen aufgefallen ist. Es sind doch über lange Strecken wirkliche Textmontagen?
W: Daß Texte beim Cinéma Vérité eine grosse Rolle spielen, ist ja klar. Das ist bei allen amerikanischen Filmen dieser Zeit so. Wenn Du dir THE CHAIR (Richard Leacock 1961) zum Beispiel ansiehst, wie der Rechtsanwalt mit Telefongesprächen darum kämpft, den zum Tode Verurteilten frei zu kriegen. Das sind alles riesige Textpassagen. Diese Filme bestehen auch aus Worten und das ist, wie ich meine das Schöne am Cinema Direct, daß man Menschen ihre Stimme zurückgibt. Das war ja ein Teil meiner propagandistischen Anstrengungen zu sagen: Lasst die Anderen reden, also nicht wir, nicht der gebildete Mittelstandsbürger soll die Reden schwingen, nicht immer nur das Oxford-English, sondern das gesprochene Englisch. Daß man bei IN DER FREMDE die Sprache der Bauarbeiter hört, daß man die poetische Ausdrucksweise der Landarbeiter hört, der Bauern, daß diese Sprache zu ihrem Recht kommt, daß war damals neu. Das war das Wunderbare, das mir das Cinema Direct gebracht hat: Daß man Sprache zu hören bekommt. Heute ist das vielleicht selbstverständlicher, weil in jeder Talkshow ja alle möglichen Leute auftreten, wobei man natürlich nachfragen kann, ob diese Sprache noch ihre Aura hat. Ich meine immer, die Kunst besteht in dem Vermögen den Augenblick zu erlauschen und das Lauschen auch aufzunehmen, in dem diese Leute zu ihrer Sprache finden.
S: Aber das ist doch ein Umgang mit Text?
W: Ja, das ist ein Umgang mit Text. Aber wie ist das mit meinen eigenen Texten, die geschriebenen Texte, die ja nicht spontan von mir kommen? Ich bin ja nicht Jonas Mekas, der –ich weiss nicht ob es stimmt aber man sagt es– teilweise spontan auf seine Filme spricht. So was mach ich ja nicht.
S: Wie entstehen deine Sprechertexte?
W: Schon beim Schnitt schreibe ich den Entwurf und dann verbesser ich den Text bis zum Schluss. Ich tipp nicht noch einmal alles sauber ab, um es übersichtlich zu haben, sondern im allgemeinen benutze ich dieses einmal getippte und verbesserte Manuskript mit allen Hinweisen und Verweisen. Wenn ich die Texte drauflese, dann nehme ich immer diese überschriebenen Blätter und muß mich durch mein Durchgestrichenes und Verbessertes hindurchfinden und lese es auch so. Wenn ich dann die Sprachaufnahme mache, spürt man vielleicht noch die Spur der Entstehung.
S: Du engagierst keinen Sprecher für deine Texte?
W: Nie! Das hängt auch mit den anderen Stimmen zusammen, die ich im Film habe. Also wenn ich nun eine schlechte Sprecherstimme hätte, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Das habe ich mir immer zugetraut und das wollte ich auch. Das ist für mich wie das Signalisieren einer Nebenspur: Daß der Film ein Produkt ist, das von Leuten gemacht worden ist. Der Kameramann hat seine Handschrift da drin und ich meine vor allem durch die Stimme. Die Tonalität der Stimme vermittelt etwas über den Entstehungsprozess in der Zeit. Meine Stimmlage verändert sich, manchmal habe ich erregter gesprochen oder schneller, in den frühen Filmen auch heller – wie auch immer, ich hab nie länger drüber nachgedacht, selbst zu sprechen war für mich instinktiv richtig.
S: Gibt es Töne, akustische Stimmungen, die für eine bestimmte Zeit so charakeristisch sind, daß du das Gefühl bekommst, die Zeit zu hören?
W: Manchmal fallen mir Sachen ein, aber nicht so oft, das geschieht eher unbewusst. Da kommen Bruchstücke von Worten hoch, Zitate, Lieder, sowas taucht manchmal auf. Aber es ist nicht so präzis, wie du es beschreibst. Das ist eher so, daß die Sachen eher eine Räumlichkeit bekommen und nebeneinander oder zusammen stehen – also nicht so wie eine Zeitachse.
S: Denkst du oft an deine Filme?
W: Nein, es ist nicht so, daß ich mich die ganze Zeit mit meinen Filmen beschäftige. Aber manchmal ist es so, daß ich mich mit ihnen wie in einer Räumlichkeit befinde. Natürlich ist IN DER FREMDE inzwischen weit zurück, aber manchmal rücken so Sachen wieder nach vorne.
S: Was war an dem Tagesspiegel-Film so skandalös?
W: Der Verleger Franz-Karl Maier fühlte sich nicht richtig dargestellt. Vor allem in dem zweiten Teil versuchen wir etwas von seiner Geschichte aufzuzeigen. Und der erste Teil ist, na, ja, wie er halt ist: Das war wohl auch auf Anregung der Studentenbewegung, daß ich irgendwie dachte, man müßte etwas über die bürgerlichen Medien machen, gerade über so etwas renommiertes wie über den Tagesspiegel’. Ich habe dann an zwei Beispielen versucht aufzuzeigen, wie eine Nachricht entsteht, wie der Betrieb funktioniert und wie so ein meinungsbildendes Blatt seine Manipulationen macht.
S: Gibt es den zweiten Teil des ‘Tagesspiegel’-Films (EIN FILM FÜR WEST-BERLINER ZEITUNGSLESER UND JOURNALISTEN) noch?
W: Es gibt ihn glaube ich noch versteckt. Er wurde mit Gerichtsbeschluß verboten und mußte zerstört werden, eine Arbeitskopie haben wir verschwinden lassen.
S: Gibt es eine Möglichkeit, den Film heute wieder zu sehen?
W: Glaube ich nicht. Mir gehören die Filme ja nicht, die gehören dem NDR.
S: Hast du dich bei dieser Auseinandersetzung vom NDR im Stich gelassen gefühlt?
W: Nein, nein, die haben mich in gewisser Weise sogar unterstützt. (Der damalige NDR-Intendant Dietrich) Schwarzkopf, der mir ja sonst sehr skeptisch gegenüberstand, hatte ein gewisses Interesse, weil er selber mal beim ‘Tagesspiegel’ gearbeitet hat.
S: Wären die unbefangenen Reaktionen der Bauarbeiter auf Euch bei IN DER FREMDE vor dem Hintergrund der allgemeinen Medienerfahrung heute noch möglich?
W: Ich glaube schon. Das ist das, was du selbst mal als ‘Haltung’ beschrieben hast, wie man als Filmemacher auftritt. Natürlich gehen heute die Leute viel selbstverständlicher damit um, daß irgendwelche Medienmenschen auftretren und filmen. Aber die Situationen in meinen Filmen entstehen aus einem Vertrauensverhältnis, das über Wochen aufgebaut wird. Ich glaube schon, daß es noch genauso wäre. Die Leute sehen ja, daß man auch arbeitet, um diesen Film zu machen. Das würde heute wieder ganz ähnlich ablaufen.
S: “Dokumentation ohne Agitation, was vermag sie zu leisten” fragt Wolfram Schütte nach INDER FREMDE und “taucht hier nicht vielleicht eine Grenze der filmischen Möglichkeit auf, ist hier nicht vielleicht doch die Wiedergabe des Banalen ein Ding aus dem Nichts hervorgeht?” endet in epd eine Kritik zu HEILGABEND AUF ST.PAULI. Das sind Fragen, die Ende der sechziger Jahre am Schluss eigentlich positiver Rezensionen stehen. Vor welchem Hintergrund entstanden solche Einwürfe?
W: Schütte stand Ende der Sechziger wohl ganz auf Seiten der eingreifenden Linken und hat wahrscheinlich gar nicht erkannt, was wir da gemacht haben, weil er, wie die Studentenbewegung überhaupt, wortgläubig war. Das Verbalisieren war Trumpf unter den linken Studenten. Ich stand auf ihrer Seite, doch war eine meiner stärksten Bemühungen als Dozent an der Film- und Fernsehakademie, ihnen beizubringen, daß man in die filmische Beobachtung Vertrauen haben kann. Damit kann man etwas rüberbringen, was mit einem Kommentar nicht zu schaffen ist. Wenn man Filme aus der Zeit wiedersieht, fällt einem diese Kommentargläubigkeit sofort auf. Mir ging es darum, nicht parolen- und textgläubig zu sein, sondern der Methode des Cinéma Vérité zu vertrauen und sich darauf einzulassen mit diesen Leuten, also mit der Arbeiterklasse umzugehen. Ich glaube das Entscheidende war damals, daß diese linken Bildungsbürger der Arbeiterklasse letztendlich wohl nicht zutrauten, ihre eigene Sache im O-Ton auszudrücken. Die glaubten, ihnen das mit gesetzten Worten vorerzählen zu müssen.
S: Die Frage Eingreifen oder Nicht-Eingreifen war beim Dokumentarfilm nicht nur damals ein beliebter Streitpunkt. Wenn ein Söldner und Mörder vor der Kamera ganz offensichtlich Lügen erzählt, wie in Romuald Karmakars WARHEADS (1989-92), fordert ein Teil der Kritik regelmäßig eine deutliche, natürlich verbale Korrektur im Film, sonst wird der Filmemacher umstandslos der Kumpanei bezichtigt.
W: Ich würd ja nie auf die Idee kommen, zum Beispiel einen Film mit Neo-Nazis machen zu wollen. Dafür müsste man eine andere filmische Form finden. Ich würde denen keinen Raum einräumen wollen. Ich habe ja Zeit meines Lebens nur Leuten Raum gewährt, denen meine Sympathie gehört. Das ist ein schwierigen Bereich. Ich weiss, daß Heynowski/Scheumann sich eingeschlichen haben. Bei Kongo-Müller war das glaube ich so (DER LACHENDE MANN, Walter Heynowski, Gerhard Scheumann, DDR 1965/66). Das sind so kritische Nummern, die man überlegen kann. Ich glaube nicht, daß jede Form für Alles und Jedes anwendbar ist.
S: Wenn in Deinen Filmen gelogen wird, greifst Du auch nicht ein.
W: Das sind die kleinen Flunkereien, die ich ja schön finde. Ich würde ja jedem, wie mir selber auch zugestehen, was vorzuflunkern, damit sich etwas anderes rundet, das gehört doch mit dazu. Das Interessante ist doch, daß man sich darüber eine Meinung bilden kann, zum Beispiel über Ferdinand in EMDEN GEHT NACH USA, als er zu spinnen beginnt und anfängt, sich anders darzustellen als er tatsächlich ist. Wenn er da in seiner ostfriesischen ‘halben Landwirtschaft’ rumerzählt und den eigenmächtigen ‘King auf Grund und Boden’ darstellt, kann man doch sehen wie weit das ein Wunschtraum, Wunschbild, Selbstdarstellung, Angeberei, Protzigkeit, Mannestum, alles Mögliche ist. Das würde ich immer zulassen, weil ich ihn grundsätzlich akzeptiere. Und wenn ich jemanden akzeptiere, müßte ich ihm eigentlich auch zugestehen, daß er angibt, daß er irgendwas macht, um seine Brust zu zeigen. Einem Nazi würde ich diesen Raum niemals gewähren, das ist was anderes.
S: Wie kam es zu deiner England-Begeisterung?
W: Ich bin durch die Beatzungsmächte geprägt worden. Nach dem Krieg war der amerikanische Einfluß der bedeutenste. Die Befreiung über den Jazz ist ja schon oft thematisiert worden, aber das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was das für unsere Generation bedeutet hat. Der Einfluß des Armeesenders war sehr stark. Ein Jahr war ich Austauschstudent in Amerika. In Berlin spielte England genauso eine Rolle. Ich habe mir im British Council Bücher ausgeliehen und Englisch auch immer schon nebenbei gelernt. Eines der Bücher, die ich mir früh ausgeliehen habe, waren Aufsätze von John Grierson. Daß ich ausgerechnet das gelesen habe und es auch noch interessant fand, war auch einer dieser merkwürdigen Zufälle. Weil ich in Berlin im englischen Sektor wohnte, habe ich früh englische Filme gesehen.. Die amerikanischen wurden damals glaube ich nur im amerikanischen Sektor gezeigt, wo ich sie auch gesehen habe. In England habe ich dann das Free Cinema kennengelernt. England ist bei mir immer wieder aufgetaucht. Später in der Filmakademie habe ich mir nochmal die ganze englische Dokumentarfilmschule angesehen. Diese Stränge kulminierten dann in YORKSHIRE. Da habe ich sofort gedacht, ‘das ist was, da muß ich hin!’.
S: “Die Bürgerlichen spekulieren auf die Vergesslichkeit” sagt Harry an einer Stelle in HAMBURGER AUFSTAND. Ist das ein Motiv für deine Arbeit?
W: Ich mißtraue den großen Absichten immer sehr. Es ist zwar ganz schön zu sagen, daß man etwas gegen die Vergesslichkeit macht und ich vermute, daß es vielleicht auch ein Motiv ist, aber letztendlich sind es ja auch immer persönliche Gründe, etwas zu tun oder zu lassen. Die unscheinbaren Sachen interessieren mich aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ich sie vermutlich auch in meinem eigenen Leben für wichtig halte. Diese unscheinbaren Momente gibt es zum Beispiel gerade in meinen Ruhrgebietsfilmen. Wie der Alltag abläuft, nachdem das große Ereignis vorbei ist, die Pausen, die da entstehen, das sind die entscheidenden Sachen. In meinem eigenen Leben habe ich empfunden, daß diese Momente das Leben mehr bestimmt haben, als die großen Ereignisse. Das ist das Gefühl nach dem Geburtstag und nicht der Geburtstag selbst. Nicht die Feste sind die Höhepunkte, das Eigentliche, sondern wie das Leben dazwischen verrinnt. Wie der Vormittag vorbeigeht, der Nachmittag, die Stunden, wo es mühsam vorangeht, wo man auch arbeitet, wie man das durchsteht – das sind die Momente, um die ich wahrscheinlich immer selbst kreise und die ich in irgendeiner Form zu poetisieren versuche, um sie greifbar zu machen – eben auch für mich.
S: Beim HAMBURGER AUFSTAND lagen die Ereignisse, um die es ging, zum Teil fast fünfzig Jahre zurück.
W: Der kommunistische Widerstand war anfang der siebziger Jahre ein gründlich verdrängtes Thema. Es ging doch darum, diesen ganzen Studenten, die sich damals ewig auf die Arbeiterbewegung bezogen haben, zu zeigen, wo die Leute eigentlich sind, von denen sie immer sprechen. Die Leute, die den Widerstand in der Nazizeit und davor eigentlich getragen haben, überhaupt zu finden war schon sehr mühsam. Da mußten wir erstmal die Sperren des Mißtrauens sprengen und wir mußten mit der DKP umgehen, die natürlich auch lieber einen Propagandafilm von uns wollte. Diese unscheinbar aussehenden Männer und Frauen, das war einfach eine unglaublich schöne Erfahrung, die wir damals machten. Das ist etwas ganz Wesentliches, daß diese Leute eigentlich die wichtigen Menschen sind.
S: Wann bist du angefangen, so zu drehen?
W: Das habe ich schon immer gehabt. Es ist eine gute Methode, die Leute ausreden zu lassen, sie nachdenken zu lassen. Nur wenn man das riskierst kriegt man das zurück, was ich immer mit der Aura beschreibe. Jetzt können die Leute ihr Lied singen und sie sind möglichst nah an ihrer Wahrheit, die ‘vérité’ also nicht die objektive oder philosophische Wahrheit, sondern die Wahrheit, die jeder Mensch irgendwo für sich hat. Wenn man das in einer Darstellung, einer Anekdote oder Erzählung bekommt, dann ist das für mich etwas sehr Schönes.
S: In deinen Filmen gibt es immer wieder Pausen, die wie Seitenblicke wirken, Blicke aus den Augenwinkeln.
W: Pause ist eben auch das Andere, das man zum Beispiel die Straßen sieht. In RHEINHAUSEN sehen wir im Abendlicht eine Straße hinunter und man hört aus dem Autoradio plötzlich eine holländische Stimme. Das bedeutet, wir befinden uns ist in der Nähe der holländischen Grenze, man kann den holländischen Rundfunk empfangen. Diese Zufälle, die natürlich auch gezielt eingefangen werden, sind ganz wichtige Momente. In RHEINHAUSEN gibt es viele solcher Momente. Nach einem Gespräch im Werk während irgendeiner Mittags-, oder Frühstückspause haben wir zum Beispiel rausgeschnitten in den ‘Reichsadler’, das ist die Kneipe, die im Film immer wieder vorkommt. Sie ist relativ leer, dann erkennt man einen der Arbeiter, den wir vorher im Werk gesehen haben, der steht da und spielt an so einem Daddelautomaten. Es gibt dieses typische Geräusch und sein Gesicht spiegelt sich im Automaten wider, man sieht die Theke und dann klingelt irgendwo ein Telefon, eine Zigarette qualmt im Aschenbecher und eine junge Kellnerin geht durchs Bild und schenkt ein Bier ein. Das sind so diese unnennbaren Momente, die irgendwie etwas wichtiges ausmachen.
S: “Wildenhahn nimmt sich Zeit” ist mit Abstand die beliebteste Floskel deiner Rezensenten.
W: Ich vermute, daß solche Momente den eigentlichen Hintergrund geben für das, was vorne politisch abgehandelt wird. Hier scheinen die Konflikte auf, die beredet werden. Die Worte erhalten in diesem Moment ihre Tiefe oder ihre Räumlichkeit, weil diese Situationen etwas darüber aussagen, warum das Ganze geschieht. Warum es notwendig ist, sich diese Mühe zu machen, wird genauso deutlich wie die Absurdität des Lebens, die zugelassen werden muß. Es ist natürlich die Frage, ob solche Szenen auch als so etwas empfangen werden, wie ich sie einsetze. Manche meinen sicherlich, ‘was soll das jetzt hier?’.
S: Von Gewerkschaftsseite kam dieser Vorwurf in schöner Regelmäßigkeit.
W: In den Konflikten bewahren wir eine gewisse Loyalität gegenüber einer, sag ich mal etwas pauschal, gewerkschaftlichen Linie. Wir zeigen, daß eine Interessenwahrnehmung stattfindet, daß man sich darum bemüht, daß die geplanten Entlassungen, keine reinen Entlassungen werden, sondern daß irgendwelche Gelder dafür zusätzlich ausgezahlt werden. Es geht darum, wie man eine Umstrukturierung schafft und sozialdemokratisch abfedert. Wir zeigen all diese kleinsten Bemühungen, die nicht der große Kampf sind, die aber vielleicht doch notwendig sind, damit das tägliche Brot erhalten bleibt.
S: Nur fehlt so ein gewisser gewerkschaftlicher Hurra-Patriotismus.
W: Das stimmt, die Bilder scheinen von einem möglichen Pessimismus, oder einer schwarzen Sicht, von Murphy oder Malone oder sowas durchsetzt zu werden: Unser aller Existenz, vielleicht ist sie sinnlos, vielleicht ist sie nicht sinnlos. Zumindest sollten diese Fragen zugelassen werden, wenigstens für den, der diese Momente wahrnehmen kann. Am Schluß von RHEINHAUSEN sieht man noch einmal den Rentner, den man vorher bei irgendeinem kleinen Fest gesehen hat. Das Fest hatte irgend eine dieser Siedlungen veranstaltet und dieser Rentner saß da mit einer Frau am Spielautomat, die küssen sich auch mal ganz kurz. Das scheint eine heitere Situation gewesen zu sein und am Schluß sehen wir ihn wieder. Er geht über dieses stillgelegte oder still zu legende Gelände und trifft irgendeinen Kollegen. Er reflektiert auch mit uns kurz darüber, was es ihm bedeutet hat, sein Leben auf diesem Gelände zu verbringen. Es täte ihm doch weh. Als er jung war, hätte er nie gedacht, daß er mal mit Schmerzen daran zurückdenken würde. Er hätte geglaubt zu denken, ‘Gott sei Dank ist diese Periode jetzt zu Ende und ich bin frei, bin Rentner’. Er dachte, er würde abhauen und sich nie mehr umsehen. Diese Momente, die so viel erklären, bekommen eine größere Wirkung, wenn vorher Pausen angedeutet sind, die diese mögliche Leere der Existenz andeuten. Es ist eben Beides da, die Bemühung, der ganzen Sache doch wieder einen Sinn zu geben und das Andere. Das hat nichts mit Politik zu tun hat, sondern, ja womit? Vielleicht ist das absurde Theater in diesen Filmen auch aufzufinden. Die Absurdität, die ja von Leuten auch ganz professionell auf die Bühne gebracht wird, von Ionesco oder von Beckett natürlich. Nicht daß ich da in irgendeiner Form literarisch gebildet bin, nur habe ich die Empfindung, daß es mit dazugehört. An gewissen Punkten der so genannten loyalen Linie der rationalen Auseinandersetzung und gewerkschaftlichen Interessenvertretung gehört die Absurdität mit dazu.
S: Ist die Offenlegung dieser Absurdität, die ja auch das Erkennen der eigenen Begrenztheit bedeutet, der Grund für die Distanz der Gewerkschaften zu deinen Filmen?
W: Ich glaube das sind die Momente, die der Gewerkschaft alle nicht behagen. Sämtliche Filme, die ich da mit den Kollegen gemacht habe, stellen auch ein Stück Gewerkschaftsgeschichte dar. Trotzdem sehen die Gewerkschaften das nicht als ihre Produkte an. Es ist ganz klar, daß zum Beispiel die EMDEN-Filme immer im Eisschrank waren und (bei Gewerkschaftsveranstaltungen) in Sprockhövel nur unter Ausschluß der Öffentlichkeit gezeigt wurden.
© Nicolaus Schröder, 2000
in: Klaus Wildenhahn, Dokumentarist. Freunde der deutschen Kinemathek (Hg.), Nicolaus Schröder (Redaktion)